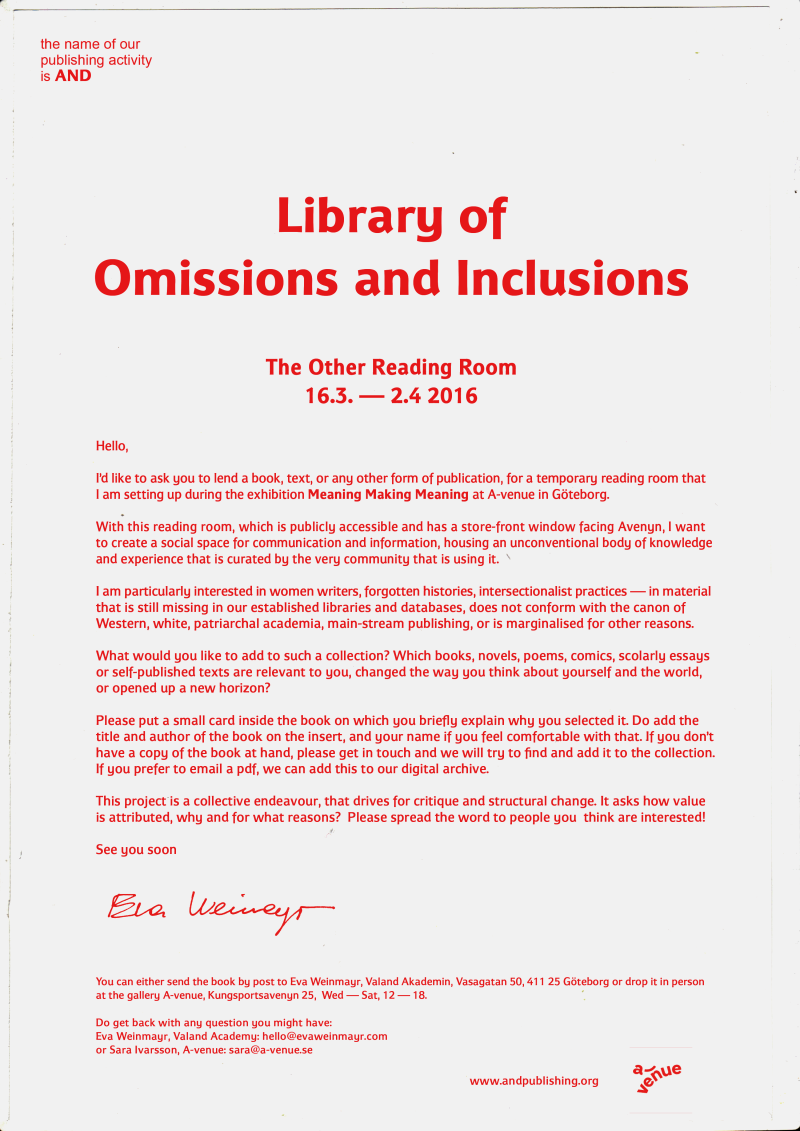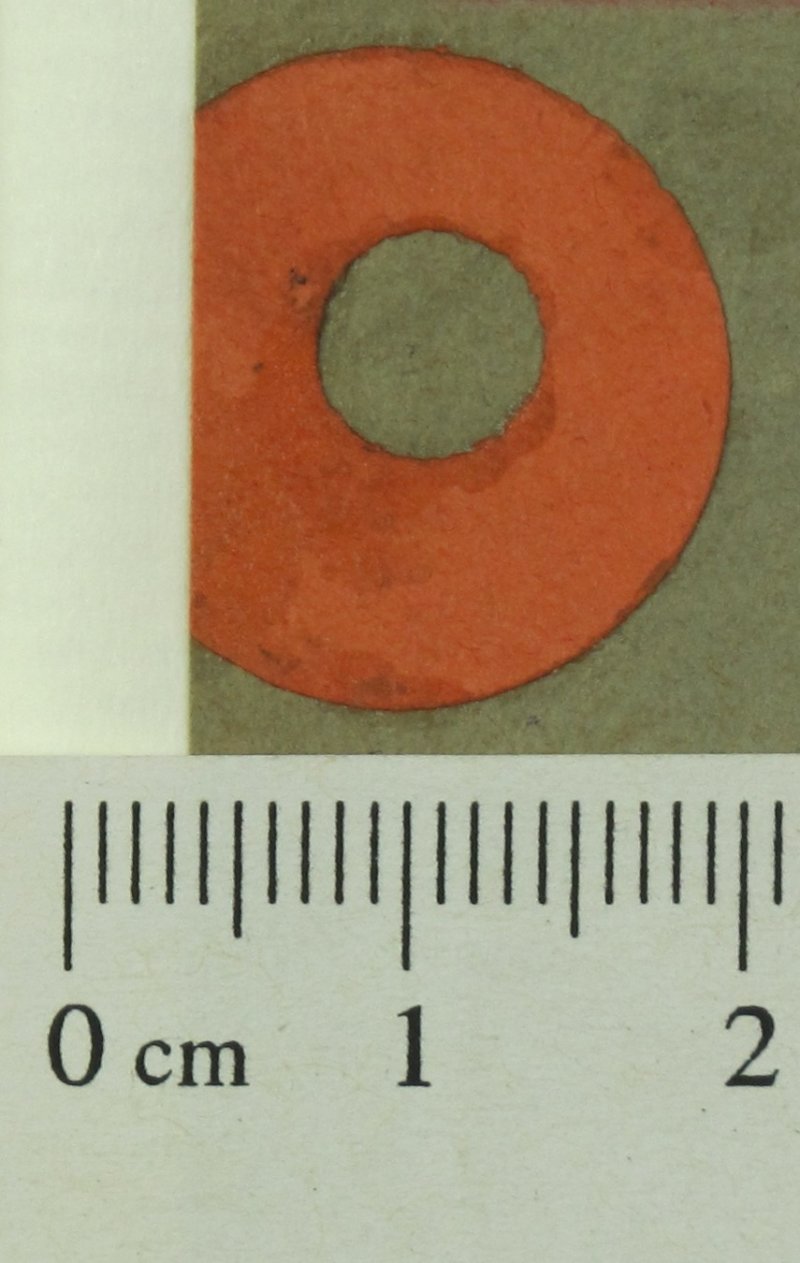Das Sitter-Ciné findet auch dieses Jahr wieder statt vom 27.08.–30.08.2024.
Das Sitter-Ciné findet auch dieses Jahr wieder statt vom 27.08.–30.08.2024.
Stiftung Sitterwerk
Sittertalstrasse 34
CH-9014 St.Gallen
+41 71 278 87 09
post@sitterwerk.ch
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 9–17 Uhr
Sonntag, 14–18 Uhr
Samstag geschlossen

Ina Mertens, Kunsthistorikerin und Fachreferentin an der UB Bern, hat im Workshop «Ortsspezifisches Vokabular: Herstellungs- und Produktionsprozesse» vom 31. März 2021 die Idee eines unarchivierbaren Raumes eingebracht, den es zu verteidigen gilt, und dessen Poesie sich durch Normverschlagwortung nicht immer spiegelt. Die Perspektive und Leitideen der Diskussion aufgreifend, vertieft sie in ihrem Essay grundlegende Fragen zum Wesen von Schlagwörtern.
Meine Schwester nannte in ihrer Kindheit rote, gelbe und grüne Paprika «Afrika». Sie knabberte an «Afrika» und freute sich.
1980 wurde das als herzig empfunden und lange korrigierte sie niemand. Mehr noch, auch in der Familie wurde «Afrika» zu einem geflügelten Wort für das Gemüse – einer Art Code, der nur von einer Handvoll Personen dechiffriert werden konnte.
Mit 20 Jahren zog ich nach Wien. Nun strömten neue kulinarische Bezeichnungen in mein Bewusstsein. In Bäckereien fanden sich Topfengolatschen und Buchteln, überhaupt überall: Mehlspeisen!
Beim Gemüse lagen die Paradeiser neben dem Karfiol. Rasch gewöhnte ich mich an die neuen Namen für Altbekanntes und kaufte nun den «Vogerlsalat», den ich noch als «Feldsalat» kannte.
10 Jahre später: Umzug in die Schweiz. Mein begehrtes Grün hiess nun «Nüssler». Und die Paprika? Nun muss ich nach Peperoni fragen.
Vogerl-, Feld- und Nüsslisalat sind eigentlich synonym. Semantisch bedeuten sie dasselbe und dennoch sind die verknüpften Rezepte regional verschieden.
Informationswissenschaftlich sind die unterschiedlichen Bezeichnungen interessant, denn es wäre ja wünschenswert, dass auch die Feldsalat-Essenden vom Nüsslerrezept mit Ei erfahren könnten – schon für die Abwechslung.
Dazu müsste man wissen, dass alle das Gleiche meinen. Mit einem Thesaurus lässt sich diese Information in ein Suchsystem integrieren und im besten Fall ist es nicht mehr wichtig, die anderen Bezeichnungen zu kennen. Durch das Zusammenführen wird die sprachliche Vielfalt reduziert. So verbessert sich das sogenannte Information Retrieval; das heisst relevante Informationen sind leichter zugänglich – hier Rezepte aus 3 Ländern.
Was ist aber mit dem Bienenstich? Oder dem Berliner?
In diesem Kontext, lassen meine Fragen vielleicht an Hefegebäck denken. Um aber den Kuchen, beziehungsweise den Krapfen oder Pfannkuchen (und hier haben wir wieder den Salat!) semantisch vom Insektenstich oder dem deutschen Hauptstädter zu trennen, müssen die Mehrdeutigkeiten geklärt werden. Dabei geht es nicht mehr um Begriffszusammenführungen. Die Wörter müssen nun den Bedeutungen entsprechend getrennt werden.
Der sprachlichen Benennungsvielfalt wird in Bibliotheken Rechnung getragen, indem normiertes Vokabular eingesetzt wird, um Medien zu erfassen und zu beschreiben. Seit einiger Zeit wird dafür die GND verwendet, die «Gemeinsame Normdatei», eine von der DACH-Region kooperativ gefütterte Datenbank für Personen, Körperschaften, Kongresse, Geografika, Sachschlagwörter und Werke, die aus den früher getrennt geführten Normdatenbanken für Personen, Körperschaften und Schlagworten gewachsen ist.
Die Datensätze sollen eindeutig Personen, Gebäude, Ereignisse etc. identifizieren, beschreiben und im besten Fall darüber hinaus auch Beziehungen zwischen Entitäten herstellen. So ist im GND-Satz für «Paprika» auch der Begriff «Peperoni» hinterlegt. Er verweist allerdings nicht auf das Schweizerdeutsche Idiom, sondern auf die Verwandtschaftsbeziehung der Gemüse.
Es ist eine Errungenschaft der GND, dass man für ein Medium von Andy Warhol (bei dem Warhol der Verfasser ist) denselben Datensatz verwenden kann, wie für ein Medium über Andy Warhol (bei dem Warhol das Thema ist). Es klingt fast albern, das zu loben. Als die Normdatenbanken noch gesplittet waren, war das allerdings nicht so.
Anders als bei der Katalogisierung, der sogenannten «formalen Erschliessung», (der Katalogaufnahme «nach Gestalt», Warhol als Verfasser) gibt es bei der Schlagwortvergabe, der inhaltlichen Erschliessung («nach Gehalt», Warhol als Thema) einen gewissen intellektuellen Spielraum, der allerdings durch die RSWK (die Regeln zur Schlagwortkatalogisierung) beschränkt ist. Medien sollen prägnant, pointiert, aber auch «neutral», nicht wertend, erfasst werden. Bei zwielichtigen, mit einem schrägen Weltbild verkoppelten Publikationen ist das nicht immer leicht. Mit normiertem Vokabular ist es verhältnismässig schwer auszudrücken, dass ein Werk beispielsweise rassistisch ist. Es fällt hingegen leicht zu zeigen, dass es von Rassismus handelt. Normvokabular ist selten ein Instrument der Feinheit.
Und dennoch: Um möglichst präzise Inhalte zu definieren, braucht man auch präzises Vokabular. Beim ersten «Finders, Keepers»-Workshop hat Lothar Schmitt seinen Einsatz für die Unterscheidung zwischen Louvre, dem Museum (als Körperschaft) und Louvre, dem Gebäude (als Geografikum) beschrieben. Im alltäglichen Sprachgebrauch sind das Spitzfindkeiten. Bei Normvokabular sind diese Unterscheidungen nicht unerheblich.
Lange galt die knappste Form der Inhaltserschliessung auch als die höchste Kunst der Bibliotheksarbeit. Heute ist das anders. Zum einen werden E-Medien in den meisten Bibliotheken nicht «intellektuell» oder – wie es auch heisst – «nach Autopsie» verschlagwortet. So durchläuft ein gehöriger Teil der im Katalog verzeichneten Medien schon gar nicht mehr diesen Prozess. Zum anderen werden Kataloge auch anders «angereichert», zum Beispiel durch gescannte Inhaltsverzeichnisse. Auf diese Weise sind auch Aufsatz- und Kapiteltitel suchbar. Oder – wie es auch im Sitterwerk der Fall ist – indem der Umschlagtitel in die Anzeige integriert wird. Ob ein Buch von Interesse ist, kann so anhand vielseitiger Eindrücke bewertet werden.
Der Kubikat, also der kunsthistorische Bibliothekskatalog im deutschsprachigen Raum, bietet gegenläufig zum Trend immer noch Schlagwortketten. Das heisst, es hängen liebevoll aus GND-Vokabular zusammengesetzte «Abstracts» am Katalogisat. Diese Ketten herzustellen ist mühevoll und die Idee dazu stammt noch aus Zeiten des Zettelkatalogs. Der Sucheinstieg sollte nicht nur über Autor*innen- oder Titelangaben möglich sein – auch inhaltliche Aspekte waren über die Ketten in das Nachweisinstrument integriert. Es war ein schlauer Versuch, Wissen ohne Computerunterstützung so zu fassen, dass es aufgefunden, nachvollzogen und weitergenutzt werden kann. Ein Problem, dem bis heute Suchmaschinen-Unternehmen weltweit mit riesigen Personal-, Finanz- und Rechenleistungen auf den Leib rücken.
Die Notwendigkeit zur Systematisierung von Büchern nahm mit der Erfindung des Buchdrucks Fahrt auf. Bibliotheken wurden räumlich aus Klöstern und Universitätskollegien befreit. Die Verbreitung und Repräsentation von Wissen wandelte sich und die (auf einmal) vielen Bücher mussten erfasst werden, um auffindbar zu sein.
Für Robert Musil, der selbst einige Zeit den von ihm verhassten Bibliothekarsberuf ausübte, standen die Notwendigkeit, die Bücher zu systematisieren und die Indifferenz, die dies gegenüber dem Inhalt auslöst, verquer zueinander. Im «Mann ohne Eigenschaften» äussert der Bibliothekar gar, dass «[w]er sich auf den Inhalt einläßt, als Bibliothekar verloren [ist]». Und dennoch (oder deshalb) kann diese komplett auf das Ordnungssystem abgerichtete Figur dem Bibliotheksbenutzer – General Stumm – nicht helfen. Er wird ratlos zurückgelassen – bis er von einem (nicht wissenschaftlichen) Bibliotheksdiener darauf hingewiesen wird, dass unlängst eine Dame ihn mit ähnlichen Anliegen konfrontiert habe. Nicht unähnlich zur Idee der dynamischen Ordnung des Sitterwerks ermöglichen die von ihr reservierten Bände dem General nun eine neue Perspektive auf seine Fragestellungen und Aufschluss über die Geisteswelt besagter Dame. Er frohlockt: «wenn ich jetzt in die Bibliothek komme, ist das geradezu wie eine heimliche geistige Hochzeit, und hie und da mach ich vorsichtig mit dem Blei an den Rand einer Seite ein Zeichen oder ein Wort und weiß, daß sie es am nächsten Tag finden wird» Bei aller Freude ist der General sich bewusst, dass er so keine systematische Übersicht gewinnen wird. Aber wie er zu Kapitelende feststellt, sei eine vollkommene Ordnung ohnehin der Kältetod.
An anderer Stelle bekräftigt Musil als Essayist die Ambivalenz des Romanciers. Die Erschliessung der «Reichtümer unserer großen Büchereien» erkennt er als eine der wichtigsten «Organisationsfragen», weiss aber zugleich, dass die Nachvollziehbarkeit eines jeden Ordnungssystems immer ihre Tücken haben wird. Die Möglichkeit sich «rasch und richtig zu orientieren», benennt er dennoch als eine «über die Zukunft der Demokratie mitentscheidende Frage». Musils Lösungsansatz lautet: «Leserberatung» oder wie wir heute sagen – Vermittlung. Und das möglichst nicht nur für «Zungen, welche den Geschmack des Staubes für erhaben zu würdigen wissen».
Schlagwörter waren einmal als Teil dieses Efforts konzipiert und es ist diskutabel, ob sie in Zeiten der digitalen Durchdringung von Wissensräumen noch ihren Dienst tun. Wir sind uns der Grenzen der Begriffe und der Grenzen der Benennbarkeit von komplexen und oft widersprüchlichen Sachverhalten bewusst. Gerade im Sitterwerk, wo Bücherort, Materialarchiv und Produktionsstätte verschränkt sind – der Zustand des Werdens und die Fluidität dem Ort eingeschrieben sind –, ist ein zentral organisiertes System oft nicht dehnbar genug, um die Poetik des Prozesses zu spiegeln. Und doch muss man sagen, dass gerade ein Ort wie das Sitterwerk dazu prädestiniert ist, um mit der Begriffsvielfalt zu experimentieren. Es ist eine Begriffsarbeit, die sich auch aus dem weltöffnenden Charakter der Kunst speist, deren Materialität gerade dann auffällig wird, wenn sie nicht einfach in Begriffen aufgeht. Der zentrale Datensatz könnte in dezentraler Autonomie so zur Reflexion, zur Irritation anregen.
Ganz ähnlich zu unserem Familienalbum aus dem Jahr 1980.
Bibliografie
Dietrich Erben, Die Pluralisierung des Wissens. Bibliotheksbau zwischen Renaissance und Aufklärung, in: Winfried Nerdinger (Ed.), Die Weisheit baut sich ein Haus. Architektur und Geschichte von Bibliotheken, München 2011, S. 169-194.
Robert Musil, General Stumm dringt in die Staatsbibliothek ein und sammelt Erfahrungen über Bibliothekare, Bibliotheksdiener und geistige Ordnung, in: Ders., Gesammelte Werke 2, Reinbek 1978, S. 459-465.
Robert Musil, Komödie. Theaterausstellung der Wiener Nationalbibliothek [10. Juni 1922], in: Ders., Gesammelte Werke 9, Reinbek 1978, S. 1588f.