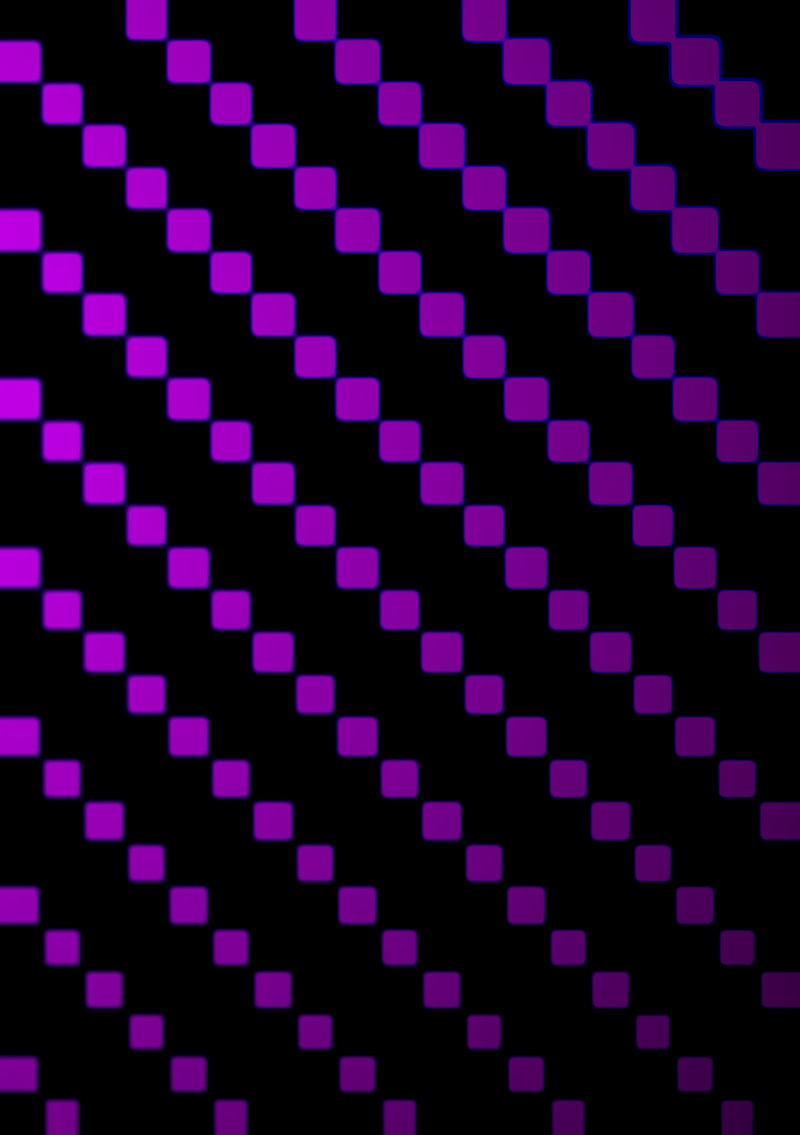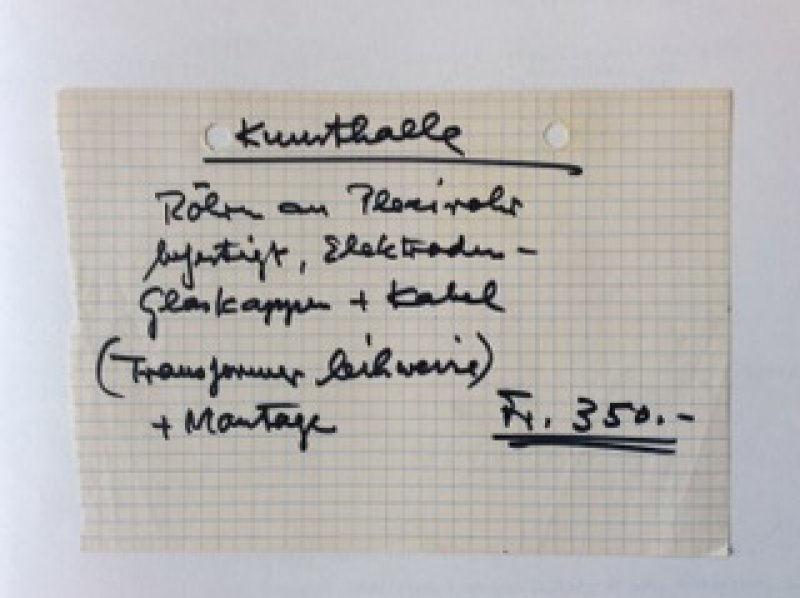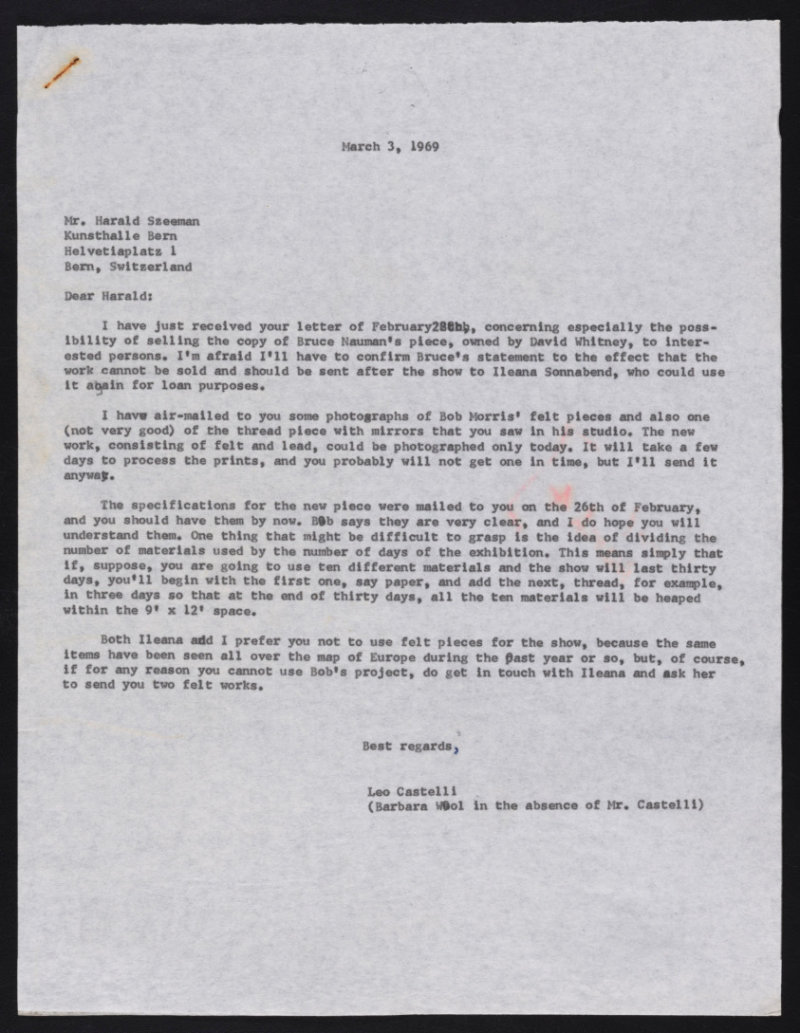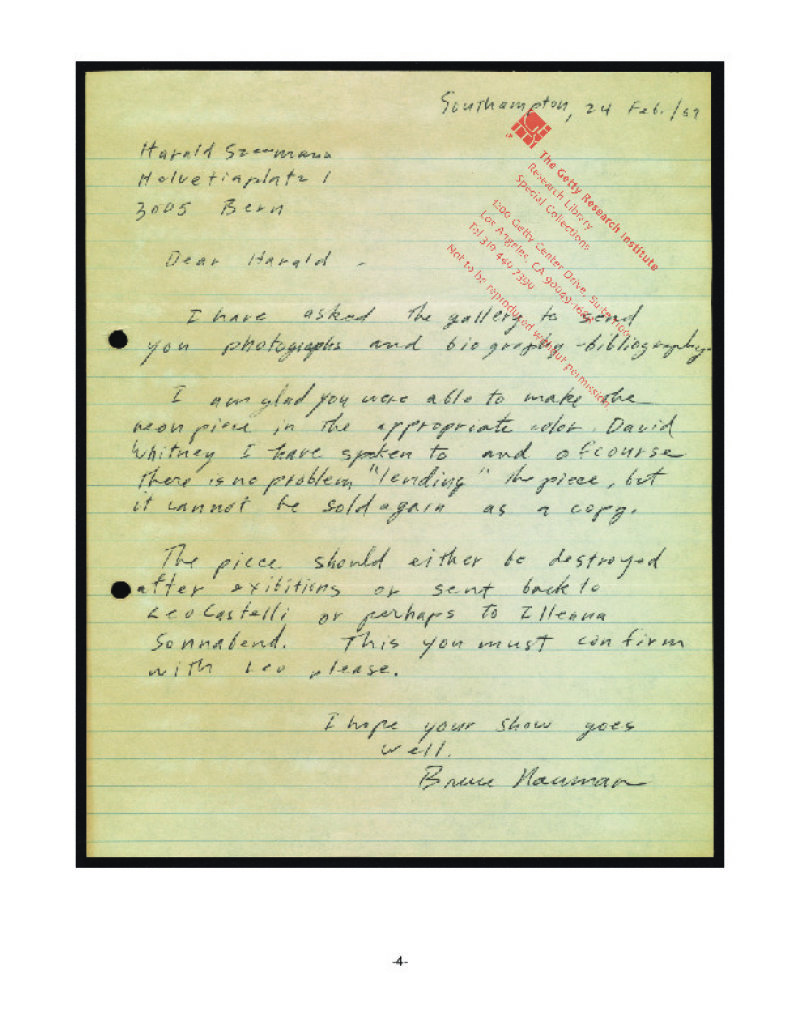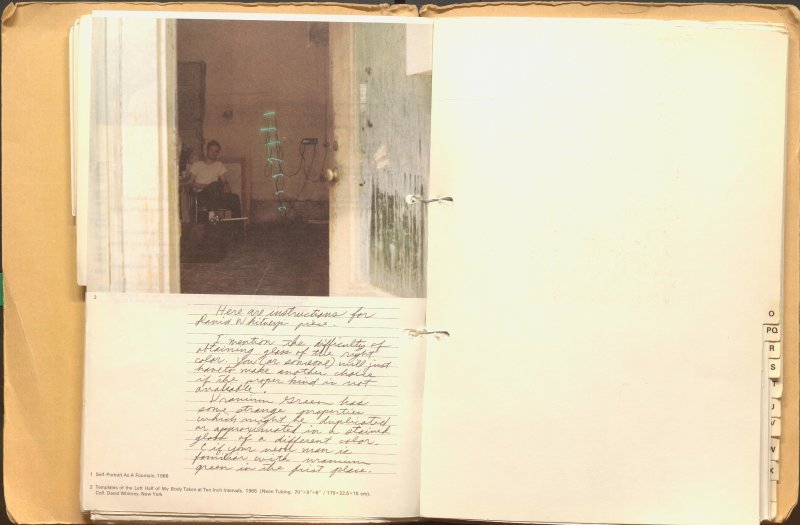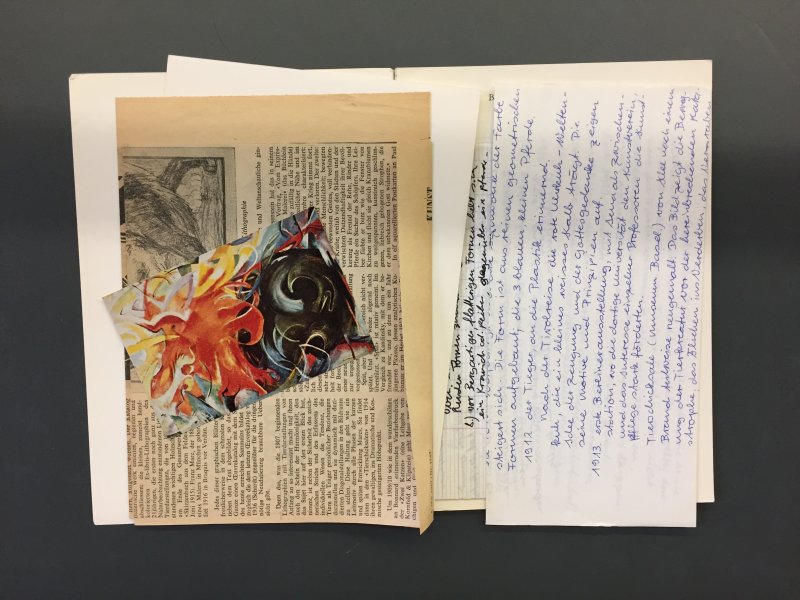Weiterbauen – Ausbau Kunstbibliothek/Werkstoffarchiv
Weiterbauen – Ausbau Kunstbibliothek/Werkstoffarchiv
Stiftung Sitterwerk
Sittertalstrasse 34
CH-9014 St.Gallen
+41 71 278 87 09 (MO–FR)
+41 71 278 87 08 (Sonntag)
post@sitterwerk.ch
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag, 9–17 Uhr
Sonntag, 14–18 Uhr
Samstag geschlossen
Ein Gespräch mit Tim Büchel
Tim Büchel ist Projektleiter in der Kunstgiesserei. Er betreut Projekte von der Offerte bis zum Aufbau und reist oft mit den Kunstwerken mit, um sie an ihren Ausstellungsorten zu installieren. Er hat den Überblick über die Produktion und muss zuweilen in letzter Minute unkonventionelle Lösungen finden, damit ein Kunstwerk vor Ort finalisiert werden kann. Manchmal stellt er auch im Herstellungsprozess fest, dass eine Idee nicht so umgesetzt werden kann wie erhofft. Dann muss er zusammen mit dem Team und dem Künstler oder der Künstlerin wieder andere Produktionswege finden. Wie geht er mit diesen stets neuen Herausforderungen um? Wie findet er die Leute vor Ort, die ihn neben dem Team aus der Kunstgiesserei unterstützen? Tim und Barbara haben über das Unerwartete in der Produktion von zeitgenössischer Kunst gesprochen und über das Kreative im Herstellungsprozess.
Barbara Biedermann: Dein Ruf eilt dir voraus: Ich habe gehört, du bist der für die schwierigen Fälle.
Tim Büchel: Oder sie werden schwierig, wenn sie bei mir sind. (lacht) Die Frage ist: Was sind schwierige Fälle? Vielleicht sind es ja auch die spannenden Fälle, bei denen nicht unbedingt von Anfang an klar ist, wie sie umgesetzt werden sollen. Es gibt verschiedene Arten von Anfragen, verschiedene Arten, wie Künstler und Künstlerinnen ticken. Und oftmals landen Anfragen mit einem experimentellen Charakter bei mir.
Inwiefern ist das Prädikat «schwieriger Fall» oder sagen wir «spannender Fall» in diesem Zusammenhang relevant?
Die Art und Weise, wie Künstlerinnen und Künstler ein Projekt angehen, kann ganz unterschiedlich sein. Die einen haben eine klare Vorstellung, was sie möchten, andere sind offener und haben nicht zwingend eine konkrete Vision, wie ihre Idee umgesetzt werden soll. Manchmal kommen sie nur mit einer Skizze oder gar nur mit einer Idee, die sie grob umreissen. Und dann versuchen wir in der Kunstgiesserei über verschiedene Wege zu einem Projektentwurf zu kommen.
Und dann wird dieser Entwurf so umgesetzt?
(lacht) Oft ändert sich wieder alles, wenn es dann konkret darum geht, einen Entwurf umzusetzen. Dann muss man einen Weg finden, wie man innerhalb des Kostenrahmens trotzdem die Ideen realisieren kann. Und das ist natürlich teilweise schwierig. Die Vorstellungen, was am Schluss entstehen soll, und der Weg dahin sind manchmal nicht einfach zu vereinbaren.
Und obwohl du das weisst, bist du immer wieder für solche Projekte zu gewinnen?
Ja, ich mag solche Projekte eigentlich lieber als die, bei denen immer gleich klar ist, was zu tun ist: Man macht ein Negativ, dann wird die Form in Metall übersetzt und dann war es das schon wieder. Aber natürlich sind die unklaren Projekte auch ein wenig aufwühlender.
In welchem Sinne?
Sie sind ungewisser. Man befindet sich lange in einem «vagen» Status, das muss man aushalten können.
Vermutlich bleibt dafür viel mehr Spielraum für Kreativität?
Klar, im Vagen entsteht viel. Man probiert etwas aus und schaut dann, was dabei herauskommt. Und wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann sucht man nach einer neuen Lösung und probiert etwas anderes aus, zum Beispiel Kombinationen von Techniken oder Verfahren, die man sonst von der Industrie kennt. Man probiert, wandelt sie ab oder modifiziert. Und so kommt man auf ein Resultat, wie es die Industrie niemals wünschen würde, die halt das Glatte, Perfekte sucht.
Kannst du mir ein Beispiel nennen, wo du Industrieverfahren angewandt und abgewandelt hast?
Für Kerstin Brätsch haben wir damals überdimensionierte Münzen verkupfert und vernickelt. Wir haben sie bewusst zu lange im Bad gelassen und dadurch viel zu stark beschichtet. So haben sie angefangen auszublühen. Kupfer setzt sich immer an Spitzen an, an den Stellen, wo es den kürzesten Weg hat zwischen Anode und Kathode. Wir haben die Münzen tagelang im Bad gelassen. Und damit genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man sonst in einem Galvanisierungsprozess sucht: eine einheitliche, saubere Beschichtung. Es sollte normalerweise möglichst keine Stellen geben, wo zu viel Kupfer ansetzt. Dafür haben wir mit einem externen Betrieb zusammengearbeitet.
Und wie reagieren diese Firmen, wenn ihr mit einem Kunstprojekt kommt und sozusagen gegen jede Regel verstosst, die ihrem Protokoll zugrunde liegt?
Das ist manchmal gar nicht so einfach zu vermitteln, dass wir ein Ergebnis suchen, das nicht den üblichen Normen und Qualitätsstandards entspricht. Oft sind sich Firmen nicht gewohnt, etwas zu machen, bei dem es egal ist, wenn die Qualitätsstandards nicht erfüllt werden. Im Gegenteil, wir wollen ja genau, dass es etwas verrotzt aussieht. (lacht)
Aus der Sicht der Industrie ein schlechtes Resultat.
Ja, sie verstehen dann nicht unbedingt, warum man das will, aber so ist das halt. Manchmal finden sie es jedoch auch spannend, wenn man etwas «falsch» macht und dann diese Fehler auch noch provozieren will.
Das heisst, die Kupferblumen waren euch als «Fehler» aus einer schiefgegangenen Galvanisierung schon bekannt und ihr habt das überlange Kupferbad bewusst vorgeschlagen, um an den Münzen Spitzen zu erhalten? Was war die Intention der Künstlerin? Waren das ästhetische Gründe oder hat sie mit dem Material gespielt?
Ursprünglich ging es gar nicht um eine Galvanisierung. Die Künstlerin hat sich Muster gewünscht. Dann war zuerst die Idee, diese in Bronze zu giessen. Aber die Güsse wären zu schwer geworden, die waren als Teil einer Performance gedacht, und so haben wir nach Varianten gesucht, die leichter sind. Am Anfang stand die Idee, in eine Negativform hinein zu galvanisieren und die dünne Schicht dann mit einem Laminat zu versteifen. Bei älteren Mustern, die wir auch schon gemacht hatten, hatte es an den Rändern diese Stellen gegeben mit den Spitzen. Die würde man normalerweise abschleifen, aber die haben ihr gefallen. Also haben wir doch zuerst ein Positiv aus Kunststoff gemacht und dann mit einem leitenden Lack beschichtet, um die Kupferschicht auf die Oberfläche galvanisieren zu können und diese auswuchern zu lassen. Die Münzen wurden im Nachhinein auch «Tumor Coins» genannt. Eine Serie der Münzen haben Freunde von Kerstin während der Ausstellung zusätzlich mit Edding bemalt, eine weitere Serie ging an eine Messe. Doch da waren keine Freunde anwesend. Also mussten wir auch da eine neue Lösung finden. Meine Tochter hat dann die Schriftprobe, die ich Kerstin geschickt hatte, eine Einkaufsliste, auf eine Münze gemalt. Und ein Büsi …
Als Projektleiter betreust du die Produktion, aber auch die Installation. Wie ist es denn da: auch wieder alles anders?
Ja, ich gehe mit den Kunstwerken mit. Und vor Ort passiert dann wieder ganz viel. Es gibt Werke, die einfach zum Aufstellen sind, und solche, die sind vielleicht ein bisschen heikler. Oder es passiert im letzten Moment noch ein Fehler, man bemerkt was, das nicht so gut ist und das man dann noch ausbessern muss.
Du hast bestimmt auch hier eine Anekdote!
Von Sachen, die in die Hose gegangen sind? Etwas vom Aufwühlendsten in dieser Hinsicht war eine Arbeit, die wir in London aufgebaut haben.
Was ist passiert?
Die Skulptur wurde in einer Halle vormontiert, ausserhalb von London, und sollte dann als ganzes Stück in der Nacht in die Stadt hineingefahren werden, wo sie auf den Sockel gehievt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt waren wir schon etwa eine Woche am Vorbereiten. Kurz bevor wir fertig gewesen sind, haben wir bemerkt, dass der Deckel, der auf die Zugangsklappe kommt, farblich nicht gut auf den Hauptteil gepasst hat. Die Teile sind separat lackiert worden.
Was für eine Zugangsklappe? Warum ist die wichtig?
Es gibt einen Zugang, damit man in die Plastik reingehen kann, um die Teile zu verschrauben. Und der Deckel von diesem Zugang hat nicht gepasst. Die Farbe vom Objekt ist leicht lasierend und darum ziemlich heikel zu lackieren. Und so wurde das eine Stück ein wenig deckender lackiert als das andere. Wir waren also in diesem Hochsicherheitskunsttransportlager, wo ein Mann namens Davey auf uns aufgepasst hat. Der wurde dann unser Freund und hat natürlich mit uns mitgelitten, weil er ja die ganze Zeit gesehen hat, was wir durchmachen und wie heikel das Ding war. Zusammen mit Davey sind wir am Freitagnachmittag im Industriegebiet herumgefahren und haben alle Lackierbuden abgeklappert und gefragt, ob irgendjemand dieses Zeugs machen kann.
Und, habt ihr jemanden gefunden?
Ja, einer ist vorbeikommen und hat sich das angeschaut, doch der hat uns wieder versetzt. Am Ende haben wir in einer kleinen Autowerkstatt so einen nervösen Typen gefunden, der wohl normalerweise gestohlene Autos umlackiert. (lacht) Nach ein wenig Probieren und Zittern hat er das Stück dann bei sich in der Spritzkabine lackiert. Es hat gut ausgeschaut im Vergleich mit den Referenzmustern, und wir sind zurück zur Skulptur in der Montagehalle.
Ende der Geschichte?
Nein, es war immer noch nicht gut. Zudem ist uns langsam die kleine Menge Lack ausgegangen, welche wir im Gepäck mitgebracht hatten. In einer Expressaktion mussten wir Lack nach London bringen lassen. Das war nicht ganz einfach mit den Bewilligungen und Papieren und so weiter, weil wegen dem Tunnel im Auto transportierte Lacke eine Gefahrgutverpackung brauchen. Als wir den Lack bekommen haben, merkten wir, wir können unmöglich das kleine Teil an die Farbe des grossen anpassen – wir müssen den Bereich um diese Klappe nachlackieren. (lacht) Aber das Werk war ja in diesem Kunstlager drin, indem man gar nicht lackieren durfte: bloss keine brennbaren Materialien! Die Nationalgalerie hat da zum Beispiel vieles aus ihrer Sammlung eingelagert. Am Ende haben wir durchgebracht, dass wir kurz lackieren dürfen, und so konnten wir das Werk noch rechtzeitig fertig machen.
Das heisst, du bist jetzt der Spezialist fürs Lackieren?
Nein! Ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema. (lacht)
Wie dokumentierst du ein Projekt mit so einer wilden Story?
Durch Bilder vor allem.
Mit allem was schiefgelaufen ist?
Ich schreibe das nicht alles auf, nicht im Detail. Aber ich mache Bilder, sozusagen Zustandsaufnahmen, oder notiere mir, welche Produkte verwendet wurden. Vielleicht gibt es schon im Ordner «Montage in London» einen Unterordner mit «Farbkorrektur». Aber das Hauptdokutool sind Fotos. Zum Beispiel hatte ich die Adresse von dem Typ, der das am Ende lackiert hat, noch irgendwo abgespeichert. Beim Abbau waren wir wieder in London und sind vorbeigegangen. Die Werkstatt gab es schon nicht mehr respektive der Typ hat nicht mehr dort gearbeitet.
Schade. Wobei du ihn ja nun auch nicht mehr brauchst, für die nächste Edition weisst du nun Bescheid.
Ja, bei der zweiten Edition gab es dann wieder ein anderes Problem. Aber diese Geschichte erzähle ich jetzt nicht auch noch.